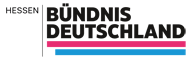Bild: KI generiert
Von Marco Groh
Wer kennt sie nicht – diese langen Spargelspitzen, die überall in der Landschaft herumstehen und uns angeblich umweltneutralen Ökostrom liefern? Es ist politischer und gesellschaftlicher Konsens, dass wir mit den Ressourcen unseres Planeten sparsam umgehen sollten, um nachfolgenden Generationen genauso ein Leben zu ermöglichen, wie wir es haben. Und es geht dabei nicht nur um die Ressourcen, die wir aufbrauchen – es geht auch um Schadstoffe, die wir erzeugen und die unsere Umwelt nachhaltig beeinflussen. Viele sind überzeugt, dass wir daher möglichst vollständig auf sogenannte „erneuerbare“ Energien umstellen müssen – und das möglichst kurzfristig. Doch wir leben in einer komplexen Welt und viele Dinge hängen miteinander zusammen. Wie die Lemminge nun alle in eine Richtung zu marschieren, ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg. Vielmehr erinnert mich die aktuelle Situation an den „Schweinezyklus“, den ich schon damals in Betriebswirtschaftslehre auf der Berufsschule gelernt habe. Was ist dieser sogenannte Schweinezyklus? Er kommt vom Begriff her tatsächlich aus der Landwirtschaft:
Exkurs Schweinezyklus
Der Preis für Schweinefleisch ist hoch. Dies bedeutet, dass es für Landwirte attraktiv ist, mehr Schweine zu züchten. Andere entdecken die neue „Goldquelle“ und beginnen mit der Schweinemast. Binnen kurzer Zeit erreichen Sie hohe Einnahmen und steigern die Produktion (Ich persönlich finde den Begriff „Produktion“ in Verbindung mit Lebewesen übrigens sehr unpassend, aber ich stelle hier nur die wirtschaftliche Sicht dar). In Folge dessen steigt das Angebot an Schweinfleisch auf dem Markt, es übersteigt die Nachfrage, der Preis fällt. Nun haben die Landwirte ein Problem. Sie können zu dem aktuellen Preis nicht mehr produzieren. Viele lösen ihr Gewerbe auf, gehen in die Insolvenz, verringern die Produktion. Die nun wieder geringere Produktion sorgt für ein geringeres Angebot und somit wieder zu steigenden Preisen. Der Zyklus ist abgeschlossen, denn nun beginnen viele wieder in die lukrative Schweinemast einzusteigen.
Warum erinnert mich die Windkraft – oder auch allgemein die erneuerbaren Energien an diesen Schweinezyklus? Nun, es wird ganz allgemein nicht mehr hinterfragt, ob Windkraft sinnvoll ist. Sie ist per Definition ökologisch neutral (zu der Diskussion komme ich später noch) und günstig (auch das ist noch separat zu betrachten). Also ist es richtig, so viele Windräder wie möglich zu bauen (also das Angebot auszuweiten). Wir kommen aber bereits in Situationen, in denen die erzeugte Strommenge größer ist als die benötigte. In der Folge verkaufen wir Strom in Spitzenzeiten zu einem Negativpreis oder wir schalten die Windräder ab. Mit anderen Worten: Wir sind bereits in einer Situation, in der wir Überproduktion haben und (im Beispiel des Schweinezyklus) die Anbieter wieder aus dem Markt gehen würden. Warum passiert das aber bei der Windkraft nicht? Weil hier die Marktkräfte außer Gefecht gesetzt worden sind. Wenn die Windräder abgeschaltet werden, wird der Betreiber trotzdem dafür bezahlt. Die Kosten hat letztlich der Stromkunde, der den nicht-erzeugten Strom in einer Mischkalkulation auf seiner Stromrechnung mit zu bezahlen hat. Staatliche Regulatorik und Subventionen (Die Erzeuger von Solar- und Windstrom bekommen einen künstlich hochgehaltenen Preis aus der EEG-Umlage – aktuell in Rückführung) haben die natürliche Reaktion verhindert und noch immer strömen weitere Anbieter auf den Markt. Allerdings: Schon jetzt haben wir einen geplanten Windpark in der Nordsee, für den es bei der ersten Auktion keinen Interessenten mehr gab.
Was wir an dieser Stelle dringend benötigen, ist eine neue Bedarfsanalyse und ein Ist-Abgleich. Solange wir aufgrund infrastruktureller Defizite (fehlende Speicheranlagen und Stromtrassen), die Windräder nicht nutzen können, sollten wir den weiteren Bau aufschieben. Erst, wenn klar ist, wie viel Windkraft wir wirklich noch benötigen, können wir den Bau weiterer Anlagen genehmigen.
Außerdem sollten wir betrachten, wie rücksichtslos neue Windkraftanlagen tatsächlich durchgesetzt werden sollen oder müssen, wenn der Bedarf eigentlich gar nicht mehr da ist. Denn die scheinbare ökologische Unbedenklichkeit darf bewusst hinterfragt werden. Warum?
Grundsätzlich ist bereits der Begriff „regenerative Energie“ irreführend. Wer in der Schule in Physik aufgepasst hat, der hat den Grundsatz der Energieerhaltung gelernt. Energie wird nicht verbraucht, sie wird lediglich umgewandelt. Im Falle der Windenergie entnehmen wir der Natur also die Energie des Windes und wandeln sie in Strom um. Was sich so einfach anhört, ist doch ein Eingriff in das Ökosystem der Natur. Wind ist dafür da, um Druckunterschiede zwischen verschiedenen Schichten auszugleichen. Luft strömt von einem Gebiet mit hohem Luftdruck in ein Gebiet mit niedrigem Luftdruck. Dabei werden Temperaturen ausgeglichen, Wetter entsteht oder wird beeinflusst. Wenn wir diesen Wind nun abbremsen, erfolgt der Druckausgleich nicht mehr, wie von der Natur vorgesehen. Die Gebiete unterschiedlichen Drucks können sich nicht mehr so einfach ausgleichen – es bleiben Ungleichgewichte bestehen, die sich weiter aufschaukeln und „nachdrücklicher“ entladen. Ja, es ist durchaus möglich, dass einzelne Unwetter, Orkane oder Ähnliches durch zu viele Windkraftanlagen erzeugt werden. Um es deutlich zu machen: Ich halte ein einzelnes Windrad grundsätzlich für unbedenklich. Aber leider machen wir ja nicht nur kleine Dinge, wir übertreiben es und bauen riesige Windparks, pflastern die Nordsee zu und erhöhen die Auswirkungen eines einzelnen Rads drastisch. Hinzu kommt die Änderung der Windströmung, die durch die Propeller des Windrads umgeleitet wird und teilweise zur Austrocknung des darunter liegenden Bodens führt. Die Stromtrassen, die den erzeugten Strom abführen, erzeugen ein elektromagnetisches Feld, dessen Auswirkungen je nach Stärke nicht nur in der Krebsforschung analysiert wird (s. hierzu auch die Seite der Europäischen Kommission Cordis: https://cordis.europa.eu/article/id/15541-research-breakthrough-on-health-effects-of-pylons/de) Zwei weitere Faktoren werden außer Acht gelassen:
1) Die Rohstoffverwendung dieser Anlagen sowie deren Recycling
2) Die Umweltverträglichkeit bezüglich des Standorts
Während man den ersten Punkt meist übersieht – denn auch beim Bau eines Kohle- oder Atomkraftwerks werden immense Ressourcen benötigt – sollte man auf kleine Details durchaus aufmerksam werden. So wird in Windrädern derzeit als Isolationsgas noch immer Schwefelhexafluorid (SF₆). verwendet – ein Gas, das auf die Erderwärmung einen um den Faktor 22.800 höheren Einfluss hat als CO2. Nach Angaben der ARD (https://blackout-news.de/aktuelles/isoliergas-sf6-in-windkraftanlagen-22-800-mal-schaedlicher-als-co2/) trägt dieses Gas „mehr zum Klimawandel bei als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr“. Hinzu kommt das Material für die Rotoren, welches vom Wind abgeschmirgelt wird und als Mikroplastik von Mensch und Tier aufgenommen wird. Leider ist dieser Kunststoff auch noch GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff und es wird diskutiert, ob er ähnlich gefährlich ist wie Asbestfasern (https://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/verborgene-gefahren-der-windenergie/) .
Und natürlich spielen seltene Erden eine Rolle, die auch hier benötigt werden und deren Gewinnung zu Recht immer wieder kritisiert wird. Es stellt sich die Frage ob nach dem Lieferkettengesetz überhaupt seltene Erden in der EU bezogen werden dürfen.
Bei der Umweltverträglichkeit vor Ort spielt es eine große Rolle, wo ein Windrad gebaut wird. Unzweifelhaft ist die Effizienz in windreichen Gebieten (also die flachen Felder im Norden des Landes) deutlich besser als im eher windarmen Süden. Trotzdem geht man mit dem Holzhammer durch die Gegend und reklamiert, dass jedes Bundesland die Windenergie auszubauen habe. Reden wir in vielen Teilen davon, dass wir schützenswerte Waldbestände habe, wie z.B. den von Wildkatzen bewohnten Buchenwald im hessischen Sülzert (Freigericht), so ist dies nicht mehr relevant, wenn es um Windkraft geht. Was ist schon eine gerodete Waldfläche, wenn es um das globale Klima geht?
Doch hier besteht ein großer Denkfehler. Was bringt es, ein Klima zu retten, wenn wir die eigentliche Umwelt dafür zerstören? In der Diskussion um Schadstoffe steht ein Gas aktuell ganz vorn in der Debatte, welches zu 0,04% in unserer Atemluft enthalten ist, und ohne dass es auf dieser Erde kein Leben geben würde: CO2. Die „organische Chemie“ beschäftigt sich mit Kohlenstoffverbindungen, weil eben genau diese neben Wasser und Sauerstoff dafür sorgen, dass unser Leben so ist, wie es ist. Und es ist der Wald, der mit diesem CO2 arbeitet. Es grenzt schon an Idiotie, für die Windkraft ausgerechnet Flächen zu nutzen, die dafür sorgen, dass der CO2-Haushalt der Natur in Ordnung kommt.
Auch hier sei noch einmal betont: Ich bin nicht gegen den Bau einzelner Windräder an Stellen, an denen es Sinn ergibt. Aber ich bin gegen große Anlagen an schützenswerten Standorten – und hier ist insbesondere unser Wald zu nennen.
Zu guter Letzt möchte ich noch einen kurzen Ausflug in den Aktienmarkt machen. Was lernt man als Anleger mit als Erstes? Die Risikostreuung. Wenn man nur in eine einzelne Aktie investiert und ausgerechnet dieses Unternehmen in eine Schieflage gerät, dann hat man „Pech“ gehabt. Hat man aber einen schönen Strauß an verschiedenen Anlageformen, dann kann man einen Ausfall gut kompensieren und der Gesamtertrag des Portfolios ist zwar nicht sensationell – aber bodenständig und ausreichend.
Dies könnte man genauso gut auf unsere Energiestruktur übertragen. Wir hatten lange Zeit einen guten Mix aus Kernenergie, Kohle, Gas, Wasserkraft. Hinzu kamen dann Solar- und Windenergie. Fällt ein Energieträger aus, fangen andere das Problem auf. Erzeugt ein Energieträger (vielleicht noch nicht bekannte) Umweltrisiken, so sind diese nicht so gravierend, weil er eben nur ein Teil des Gesamtkonzepts ist. Was wir aber gerade machen: Wir setzen 100% auf Wind und Sonne – in der Gesamtenergienutzung 100% auf Strom – und sind somit sehr anfällig für die hier entstehenden Risiken.
So soll dieser Artikel zum Nachdenken anregen. Windkraft? Ja, gern. Aber in Maßen und mit Sachverstand. Wir sollten uns nicht in Panik treiben lassen, sondern besonnen vorgehen, Risiken und Chancen einschätzen, Bedarf analysieren und das umsetzen, was effizient und umweltverträglich ist. Wer in Panik agiert, zerstört das, was er am Ende eigentlich schützen wollte. In diesem Fall: Unsere Natur.